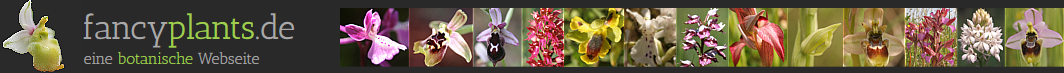Tropenökologie
Der Regenwald schafft sich sein Klima selbst.

Geneigter Leser,
jeder von uns hat umfangreiche Vorstellungen über die Tropen. Ein üppiges Wachstum, gigantische Urwaldriesen aus edlem Holz, die Äste übersät mit Bromelien, Farnen und Orchideen. Zwischen den Bäumen spannen sich Lianen einem gigantischen Spinnennetz gleich. Triaden von Insekten – Termiten, Blattschneiderameisen, merkwürdige Stabheuschrecken und farbenprächtige Schmetterlinge – bevölkern dieses grüne Paradies ebenso wie Pfeilgiftfrösche, massenhaft Schlangen, schillernde Vögel, Menschenaffen und exotische Säugetiere. Schließlich kennt man diese ganzen Tiere aus Dokumentationsfilmen und den einen oder anderen Zoobesuch.
Wer mit diesen Vorstellungen in die Tropen reist, der wird enttäuscht werden. Denn die Regenwälder unterliegen ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, unterliegen einer komplizierten Ökologie. Bereits die Kolonialmächte verdammten das grüne Paradies bisweilen als grüne Hölle.
An dieser Stelle möchte ich versuchen, Ihnen die komplizierte Ökologie der Tropen ein Stück weit zu vermitteln. Bitte behalten Sie im Hinterkopf, dass ich kein studierter Biologe bin.
Die Sonne als Motor für die Regenwaldentstehung
Ist Ihnen bislang aufgefallen, dass Regenwälder nur in Äquatornähe zwischen dem nördlichen (23°27’ N) und dem südlichen (23°27’ S) Wendekreis vorkommen? Diese Beobachtung ist relativ einfach zu erklären.
In Äquatornähe steht die Sonne nahezu senkrecht und überträgt daher dort deutlich mehr Energie als äquatorentfernt. Einerseits führt das ganzjährig zu gleich bleibend hohen Temperaturen zwischen 20 und 30°C. Zugleich führt die starke Sonneneinstrahlung zu einer erheblichen Verdunstung und zu einer deutlichen Aufwärmung der Luftmassen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kleinen Exkurs in die Welt der Physik unternehmen und die Begrifflichkeiten absolute und relative Luftfeuchtigkeit beleuchten. Die Kapazität der Luft, Wasserdampf aufzunehmen, ist temperaturabhängig. Je wärmer die Luft ist, desto mehr Wasserdampf kann aufgenommen werden. Die absolute Luftfeuchtigkeit wird in g/m³ angegeben, beschreibt also, wie viel Gramm Wasser aktuell in einem Kubikmeter Luft enthalten sind. Die relative Luftfeuchtigkeit ist hingegen eine prozentuale Angabe, die den aktuellen Wasserdampfgehalt auf den bei dieser Temperatur maximalen Wasserdampfgehalt bezieht. Die Aufnahmekapazität der Luft für Wasserdampf ist endlich, bei einem bestimmten Wert (der temperaturabhängig ist) ist die Luft gesättigt, weiteres Wasser kann nicht mehr aufgenommen werden. Kühlt nun maximal wasserdampfgesättigte Luft ab, so kondensiert überschüssiges Wasser. Ein Phänomen, das jeder schon einmal während eines heißen Bades an seinem Badezimmerspiegel beobachten konnte.
Nach diesem Exkurs wieder zurück zu den Tropen. Die warme, maximal wasserdampfgesättigte Luft steigt auf und kühlt dabei ab. Daneben treffen die Luftmassen auf stark wasserdampfgesättigte Passatwinde, die vom Meer landeinwärts wehen. Überschüssiger Wasserdampf kondensiert, es bilden sich große Wolken, aus denen ergiebige Niederschläge fallen. Die jährlichen Niederschlagsmengen sind beträchtlich. In Deutschland beträgt der jährliche Niederschlag zirka 700 bis 1.000 mm/Quadratmeter. In den Tropen werden Mindestmengen von 2.000 mm/Quadratmeter, lokal Höchstwerte von bis zu 10.000 mm/Quadratmeter erreicht.
Grüne Hölle, grünes Paradies? Üppiges Wachstum bei Nährstoffarmut
Wie gezeigt, ist die Versorgung der tropischen Regenwälder sowohl mit Sonnenlicht als auch mit Wasser exzellent. Wie sieht es nun mit der Nährstoffversorgung aus?
Die ersten europäischen Naturforscher sowie die Kolonialmächte empfanden die tropischen Regenwälder zunächst als grünes Paradies. Beeindruckende Wälder gigantischen Ausmaßes mit einer Mannigfaltigkeit an Lebewesen. Leider entstand daraus der Irrglauben, dass die Tropen ebenso ideale Bedingungen für die Landwirtschaft bieten würden. Trotz einer scheinbar endlosen Liste der Misserfolge setzt sich dieser Irrglaube bis in die Gegenwart fort. Das, obgleich während der Zeit der Kolonialmächte die Tropen angesichts ihrer erlittenen Misserfolge zunehmend statt als grünes Paradies als grüne Hölle erachtet wurden. Eine effiziente Landwirtschaft war nicht zu realisieren, der Aufwand größer als der Nutzen.
An dieser Stelle lohnt es sich, die geologischen Gegebenheiten der Tropen näher zu betrachten. Die allermeisten Regenwälder sind auf sehr altem Gestein beheimatet. Nicht selten handelt es sich dabei um mehr oder minder reinen Sandböden. Solche Böden haben zweierlei Nachteile. Sie sind sehr nährstoff- und spurenelementearm und haben daneben keinerlei Ionentauscherqualitäten. In anderen Regionen der Welt zeigen sich oftmals gänzlich andere Gegebenheiten. Viele Böden sind vulkanischen Ursprungs und somit sehr nährstoffreich, andere Teile der Welt besitzen ebenfalls gut mit Nährstoffen versorgte Böden, die zudem gute Ionentauscherqualitäten besitzen. Ein Beispiel hierfür sind die in Deutschland verbreiteten Lehm- und Tonböden. Die feinen Poren halten Ionen zurück, die später von den Pflanzen verwertet werden können.
Im Laufe der Evolution entwickelten sich diverse Anpassungsmechanismen und komplexe Kreisläufe, um mit Nährstoffarmut der tropischen Böden zurechtzukommen. Hieraus erklärt sich auch die enorme Empfindlichkeit dieses Ökosystems. Eingriffe in das Ökosystem durchbrechen zügig die Kreisläufe. Eine effiziente und andauernde Landwirtschaft ist zum Beispiel nur durch hohen Aufwand (vor allem den Einsatz von Kunstdüngern) zu erreichen.
Pilze: Effiziente Recycler
Als eines der letzten Großsäugetiere wurde 1901 die Waldgiraffe, das Okapi, in Zentralafrika entdeckt. Bemerkenswert an dieser Entdeckung war die Zeitdauer von den ersten Vermutungen über deren Existenz bis zum endgültigen Nachweis. Der Entdecker Henry Stanley versetzte Europa im Jahr 1883 in helle Aufregung, als er von seiner Kongoexpedition und dem vermeintlichen Wissen der Pygmäen über ein gestreiftes, bislang unbekanntes Waldpferd berichtete. Trotz einer intensiven Suche dauerte es 18 Jahren bis zur endgültigen Entdeckung. Bis dahin verlief die Suche erfolglos. Weder das Okapi selbst noch irgendwelche Spuren wurden gefunden. Keine Knochen, kein Fell, keine Ausscheidungen.
Ein Grund für die späte Entdeckung war der schwierige Zugang zu dem Lebensraum der Okapis, ein anderer die (für die Tropen typische) geringe Individuendichte (etwa 0,5 Okapis/Quadratkilometer) und der letzte Grund ist der generellen Ökologie der Tropen zu finden.
Die Tropen sind, wie bislang ausführlich dargelegt, sehr schlecht mit Spurenelementen und Nährstoffen versorgt. Über die Regenfälle und die Passatwinde findet ein steter, aber sehr geringer Nährstoffeintrag statt. Auf der anderen Seite finden aber auch Nährstoffverluste über die Regenfälle statt, die Nährstoffe auswaschen und über die Flüsse abtransportieren. Die Regenwälder konnten auf Dauer nur als in sich geschlossenes Gleichgewicht überleben. Die Nährstoffverluste durften die Nährstoffeinträge nicht übersteigen. Verantwortlich für die Nährstoffhomöostase sind Pilze, welche die ersten 20 cm des Bodens wie ein feinstes Sieb durchziehen. Jedes organische, tote Material (gleich ob es sich um ein Blatt, einen Kadaver oder Ausscheidungsprodukte handelt) wird innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen zersetzt. Zunächst sind an der Zerlegung Tiere (meist Insekten) und Pilze beteiligt, die gelösten Nährstoffe werden schließlich mit den starken Regenfällen in das Erdreich gespült. Dort fungiert das fein gewobene Pilzmyzel nahezu wie eine Destillationsanlage. Die Ionen werden abgefangen, vom Myzel aufgenommen und schließlich an die Bäume weitergeben. Das gefilterte Wasser sammelt sich schließlich in kleinen Bächen und Flüssen, die nahezu entionisiertes Wasser aus den Tropen abführen.
Artenreich aber individuenarm
Bei einem Besuch der Regenwälder erhält man jedoch ein komplett konträres Bild. Der Wald scheint fast nur aus Bäumen zu bestehen, der Unterwuchs ist spärlich und artenarm. Die Sichtung einer Blüte, eines Schmetterlings, eines Vogels oder gar eines Säugetiers stellt eine Rarität dar.
Für die vermeintliche Artenarmut bestehen verschiedene Gründe. Wie bereits dargelegt, stellt in Deutschland die Versorgung mit Spurenelementen und Nährstoffen kein Hindernis dar. Wasserfrösche können es sich infolgedessen leisten, in einen Weiher hunderte Eier abzulaichen, da die schlüpfenden Kaulquappen problemlos genügend Algen finden werden. So besiedeln im Spätsommer hunderte kleine Frösche die feuchten Wiesen um den Weiher herum. Für den Tropenfrosch ist die Umstände hingegen gänzlich andere. Die Gewässer sind extrem nährstoffarm. Zum Beispiel führen kleine Zuflüsse des Amazonas nahezu reinstes Wasser. Der Regenwald bietet nur genügend Algen für ein paar wenige Kaulquappen. Der Tropenfrosch geht aus der Not heraus daher am Ablaichen wesentlich selektiver vor. Manche Arten haben sich zum Beispiel auf Bromelientrichter spezialisiert. In jeden Bromelientrichter wird jeweils nur ein Ei abgelaicht.
Das Ökosystem bietet vereinfacht ausgedrückt nicht genügend Nährstoffe für mehr Individuen. Jede Art besitzt eine nur kleine Populationsgröße und ist somit nur schwer zu finden.
Die Nährstoffarmut bedingt ein weiteres Phänomen der Tropen. Tropische Säugetiere sind signifikant kleiner als ihre nächsten Verwandten aus den Subtropen oder den gemäßigten Breiten. Der Sumatratiger ist deutlich kleiner als der sibirische Tiger. Ebenso sind das Okapi (eine Waldgiraffe) und der regenwaldbewohnende Indische Elefant kleiner als ihre savannenbewohnenden Verwandten. Doch widersprechen dieser Regel nicht die riesigen tropischen Schmetterlinge oder die Anakondas und Pythons? Nein. Diese Arten nahmen Modifikationen in ihrem Stoffwechsel vor, reduzierten ihn. Vereinfacht ausgedrückt, drehten sie am Zahnrad der Zeit. Sie altern langsamer, haben einen verlängerte Wachstumsphase. Schmetterlinge der gemäßigten Breiten leben meist nur einen Sommer. Das ist genügend Zeit, um sich fortzupflanzen. Den Raupen werden genügend Futterpflanzen zur Verfügung stehen. Tropische Arten müssen selektiver Vorgehen, brauchen daher einfach mehr Zeit. Manche tropische Schmetterlinge haben eine Lebenserwartung von deutlich mehr als einem Jahr. Sie haben somit auch mehr Zeit, Nährstoffe, Spurenelemente aufzunehmen. Werden dadurch größer als ihre nicht-tropischen Verwandten.
Mannigfaltige Formen als Nischenkonzept
Die bisherigen Überlegungen betrafen überwiegend die Tierwelt. Kommen wir nun zur Pflanzenwelt. Auch in den Tropen machen die Bäume nur einen geringen Teil der Flora aus, der weitaus größere Teil besteht aus krautigen Pflanzen. Wo sind diese zu finden, wenn nicht am Waldboden?
Der etagenartige Wuchs des tropischen Regenwalds bedingt eine miserable Lichtversorgung des Waldbodens. Gerade einmal 1% des Sonnenlichts dringt bis zum Boden vor. Der Unterwuchs besteht daher meist aus Baumsämlingen, die in ihrem Wachstum stagnieren und auf ihre Chance warten: Auf die Entwurzelung einer der Urwaldriesen. Für wenige Jahre findet in diesem Fall ein „Um-die-Wette-Wachsen“ statt, das der stärkste Sämling für sich entscheiden wird. Die krautigen Pflanzen fanden jedoch einen anderen Weg, an das Sonnenlicht zu kommen. Sie verlagerten ihren Lebensraum ein paar Etagen nach oben, auf die Äste der Urwaldriesen. Dort wachsen sie als Aufsitzerpflanzen, als Epiphyten. Allerdings behielten sie ihre Autarkie, sie sind nicht zu einem parasitären Wachstum übergegangen. Hoch oben auf den Bäumen sind die Epiphyten gut mit Licht und mit Wasser versorgt. Aber auch dort besteht wie am Waldboden das Problem der Nährstoffversorgung. Als Anpassungsmechanismen sind die fleischigen Luftwurzeln der Orchideen oder die Trichterbildung der Bromelien, in denen sich Wasser und in geringem Maße auch Nährstoffe sammeln, aufzufassen.
Die Nährstoffe sind im gesamten Wald spärlich, aber einigermaßen gleichmäßig verteilt. Verteilt auf viele kleine Nischen. Daher bestand ein hoher evolutionärer Druck, sich an die verschiedenen Nischen anzupassen. Jede dieser Nischen wurde besetzt, besetzt durch eine eigene Art, die aufgrund der Anpassungen entstand, die zur Besetzung der Nische von Nöten waren. Dadurch erklärt sich sowohl der Artenreichtum der Tropen, aber auch die Individuenarmut. Es sind kleinste Nischen besetzt worden, Nischen, die nur für wenige Exemplare einer Tier- oder Pflanzenart genügend Lebensraum bieten.
Ein einzigartiges Ökosystem steht vor der Vernichtung
Dieses einzigartige Ökosystem ist stark gefährdet. Die Regenwaldfläche, die pro Minute zerstört wird, entspricht etwa 70 Fußballfeldern. Pro Stunde sind es 4.230 Fußballfelder! Es sind gigantische Flächen, die in den letzten Jahren zerstört wurden, gerade zerstört werden.
Der Hauptverantwortliche stellt die Holzindustrie dar. Zuletzt gewinnen die Fleischproduktion (Verwendung der Flächen als Weideland und für die Futtermittelproduktion) sowie die Produktion von Agrartreibstoffen (Palmöl) mehr und mehr an Bedeutung.
Es ist noch nicht zu spät. Große Teile der Regenwälder sind noch einigermaßen intakt. Allerdings muss für deren Erhalt etwas geschehen.
Wir sind alle gefordert.